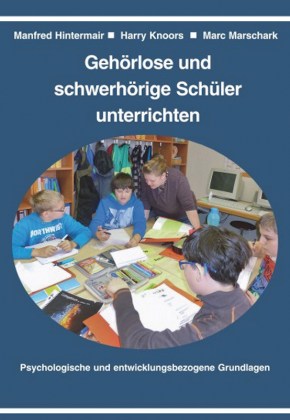Unsere Versandbuchhandlung auch für andere Bücher
![]() Sie können selbstverständlich bei uns auch Bücher bestellen, die nicht in unserem Onlineshop stehen.
Sie können selbstverständlich bei uns auch Bücher bestellen, die nicht in unserem Onlineshop stehen.
Bestellbarkeit (aus nahezu allen Bereichen) einfach über Titel | Verlag | ISBN
Schreiben Sie uns dazu einfach eine E-Mail-Anfrage: vertrieb@median-verlag.de
Manfred Hintermair, Harry Knoors und Marc Marschark
2021, 2., unveränderter Nachdruck der Auflage 2014, 368 Seiten, Softcover

Beschreibung
ISBN 9783941146440
Beschreibung
Das Buch vermittelt zahlreiche neue Anregungen und Denkimpulse. Es ist eine Bereicherung nicht nur für jede Lehrkraft an Förderzentren, Förderschwerpunkt Hören, sondern für alle Personen, die mit Kindern und Jugendlichen mit Hörschädigung arbeiten.
Professor Dr. Annette Leonhardt.
Auszug aus der Rezension in der VHN, Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete, Ausgabe 3/2016
Lange Zeit waren die Diskussionen in der Hörgeschädigtenpädagogik fast ausschließlich von der Methodenfrage (Lautsprache versus Gebärdensprache) bestimmt. Diese lähmende und fachlich extrem verkürzende Fixierung auf die Frage der zu verwendenden Sprachmodalität hat mit dazu beigetragen, dass versäumt wurde, sich um die entscheidenden Fragen zu kümmern: Wie lernen gehörlose und schwerhörige Kinder und was brauchen sie dafür an Unterstützung im Unterricht?
Das vorliegende Buch unternimmt den Versuch, hierzu auf der Basis aktueller nationaler wie vor allem internationaler Forschungsergebnisse aus den letzten Jahren, Antworten zu geben, die gestützt sind auf evidenzbasierten Daten. Es soll praktizierenden Lehrkräften als auch denjeinigen, die sich für den Lehrberuf mit gehörlosen und schwerhörigen Kindern entschieden haben, psychologische und entwicklungsbezogene Grundlagen vermitteln, die von Bedeutung sind, wenn man gehörlose und schwerhörige Kinder unterrichtet.
Wir verfügen mittlerweile über einen sehr große Fundus an empirischen Studien aus den Bereichen der Psychologie, Linguistik, Soziologie, Pädagogik, Sonderpädagogik sowie auch aus etwas entfernteren Gebieten wie Informatik, Anthropologie oder den Neurowissenschaften, aus denen wir vielfältige Erkenntnisse gewinnen können für die Gestaltung von Erziehungs- und Bildungsprozessen sowie speziell für die Unterrichtung von gehörlosen und schwerhörigen Kindern.
Wer ein Buch erwartet, das ihm genau zeigt oder gar vorgibt, wie nun Unterricht mit gehörlosen und schwerhörigen Kindern gemacht wird, wird enttäuscht. Es wäre zu einfach und dem, was wir über das Lernen gehörloser und schwerhöriger Kinder heute wissen, nicht angemessen. Die hohe Diversität der Schülerschaft, die wir heute an den Schulen (Schulen für Hörgeschädigte oder an allgemeinen Schulen) vorfinden, verbietet genau solch einfache Lösungen nach „Kochbuchrezept“. Was Lehrer und Lehrerinnen heute brauchen, um ihren Unterricht eigenverantwortlich gestalten zu können, sind theoretische Grundlagen des Lernens und was wir darüber von gehörlosen und schwerhörigen Kindern wissen. Lehrer und Lehrerinnen sind die Experten für den Unterricht, den sie machen. Das vorliegende Buch will ihnen die Grundlagen dafür bereitstellen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1
Grundlagen des Lernens und Unterrichtens
Entwicklung und Lernen – Anlage und Umwelt
Die ökologische Natur des Lernens
Ursprünge des Lernens
Schulisches Lernen
Individuelles, kooperatives und kollaboratives Lernen
Lernen und Unterrichten
Evidenzbasierte Erziehung und Bildung
Integration von Forschung und Praxis
Kapitel 2
Gehörlose und schwerhörige Schüler – Eine Einführung
Gesprochene Sprache, Töne und Hören
Hörverlust
»Einen Hörverlust haben« versus »gehörlos sein«
Als gehörloser oder schwerhöriger Schüler in der Schule im Wandel der Zeiten
Nach vorne schauen mit einem Blick zurück
Kapitel 3
Lernen fängt zu Hause an
Sprache und Kommunikation
Grundlagen sozialer Interaktion
Das kindliche Spiel als „Fenster und Raum“
Ein gehörloses/schwerhöriges Kind in der Familie
Kapitel 4
Sprachentwicklung
Sprache
Gebärdensprache
Multimodalität und Gebärdensysteme
Sprachentwicklung
Bilingualer Spracherwerb und Fremdsprachenlernen
Lautspracherwerb bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern
Gebärdenspracherwerb bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern
Von der Sprache zum Lernen
Kapitel 5
Diagnostik der Sprachkompetenz und Unterricht
Spracherwerb zu Hause und Sprache lernen in der Schule
Diagnostik der Sprachkompetenz
Optimierung des Zugangs zu Sprache in der Erziehung und Bildung
Förderung der Sprachkompetenz durch bilinguale Erziehung
Förderung der Sprachentwicklung durch Interaktion im Klassenzimmer
In der Schule Sprache unterrichten
Diagnostik der Sprachkompetenz: Wo stehen wir?
Kapitel 6
Kognitive Entwicklungsprofile gehörloser und
Intelligenz versus Kognition
Visuelle Aufmerksamkeit und visuelle Kognition
Gedächtnis und Lernen
Exekutive Funktionen und Metakognition
Soziale Kognition und Theory of Mind
Was bedeutet das alles?
Kapitel 7
Lernen und sozial-emotionale Entwicklung
Beziehungen zwischen sozialem, emotionalem und schulischem Lernen
Emotionale Entwicklung gehörloser und schwerhöriger Schüler
Soziale Entwicklung
Psychische Gesundheit und Lebensqualität
Protektivfaktoren stärken und fördern: Schüler, Familie und Schule
Was können wir also tun?
Kapitel 8
Schulische Leistung und Unterricht – Literalität
Schulische Leistungen gehörloser und schwerhöriger Schüler verstehen
Lesen
Bilingualer Unterricht für gehörlose und schwerhörige Schüler
Schreiben
Kapitel 9
Schulische Leistung und Unterricht – Mathematik und Naturwissenschaften
Mathematik
Die Kunst der naturwissenschaftlichen Erziehung
Kapitel 10
Multimediales und computergestütztes Lernen für gehörlose und schwerhörige Schüler
Die digitale Revolution
Multimediales Lernen
Merkmale von Schülern in ihren Auswirkungen auf das multimediale Lernen
Effektives Multimedia-Design für den Unterricht
Unterstützung durch Unterricht
Auswirkungen von multimedialem und computergestütztem Lernenbei gehörlosen und schwerhörigen Schülern
Die Zukunft des multimedialen Unterrichts für gehörlose und schwerhörige Schüler
Kapitel 11
Lernen und Kontext
Die Entscheidung für den schulischen Lernort verstehen
Schulische Lernorte und schulische Leistungen
Unterrichtsorganisation
Was können wir also tun?
Kapitel 12
Wie geht es weiter?
Die Kluft zwischen Theorie und Praxis schließen!
Implementierung evidenzbasierten Unterrichts
Literatur
Autorenregister
Sachwortregister
Autoren
Vorwort
Das vorliegende Buch ist aus der Notwendigkeit heraus entstanden, dass sowohl in deutschsprachigen Ländern als auch in anderen Ländern ein aktuelles, umfassendes und forschungsbasiertes Buch zu psychologischen und entwicklungsbezogenen Grundlagen der Unterrichtung gehörloser und schwerhöriger Schüler derzeit fehlt. Frühere wichtige Werke in dieser Hinsicht wie die Publikationen von Moores (2001) oder von Marschark, Lang & Albertini (2002) bedürfen angesichts zahlreicher beträchtlicher Veränderungen in der Population gehörloser und schwerhöriger Schüler im letzten Jahrzehnt, verknüpft mit dem Umstand, dass dazu in den letzten Jahren erfreulicherweise eine Menge an qualitativ hochwertigen neuen Forschungsarbeiten vorgelegt wurde, ein aktualisiertes Update. Das Problem beim Schreiben eines aktuellen Buches im Bereich der Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik liegt heute nicht wie zum Teil früher an zu wenig vorhandener Literatur, sondern vielmehr darin, angesichts der Fülle der Arbeiten den Überblick zu behalten. Es ist davon auszugehen, dass während wir diese Zeilen schreiben, möglicherweise einige der in diesem Buch dokumentierten Inhalte schon wieder durch aktuelle Daten und Befunde überholt sind bzw. vielleicht (noch) differenzierter betrachtet werden müssen. Angesichts der Fülle zu verarbeitender Informationen (und wir entschuldigen uns bereits im Vorwort bei denjenigen, die möglicherweise Arbeiten vorgelegt haben, die wir nicht berücksichtigt haben) hat es sich angeboten, zu kooperieren.
Was das konkrete Zustandekommen des Buchs angeht ist zunächst anzumerken, dass man natürlich auch ein eigenes Buch ausschließlich für die deutsche Szene hätte schreiben können. Es bot sich aber eine andere Variante an, die einen deutlich schnelleren Abschluss des Vorhabens in Aussicht stellte, dabei aber die Option eröffnete, auch Ergebnisse aus dem deutschsprachigen Raum angemessen zu berücksichtigen. So ergab sich eine Kooperation zwischen den drei Autoren dieses Buches. Harry Knoors und Marc Marschark haben zu Beginn 2014 ein englischsprachigesBuch (Teaching deaf learners: Psychological and developmental outcomes. Oxford, NY: Oxford University Press) auf den Markt gebracht. Diese Publikation ist die Grundlage für das hier vorliegende Buch, für das ergänzend aktuelle Ergebnisse aus Theorie, Forschung und Praxis in den deutschsprachigen Ländern mit integriert worden sind. Wir fanden diese Kooperation neben dem Aspekt, dass eine solche Publikation schneller realisiert und somit auch einer interessierten deutschen Leserschaft schneller zur Verfügung gestellt werden kann, als eine gute Gelegenheit, einBuch zu präsentieren, das sowohl internationale Forschung als auch Arbeiten aus dem deutschsprachigen Raum in einem Band vereint. Wir verzichten in diesem Buch auf die jeweilige Nennung beider Geschlechter ausschließlich zugunsten der Lesbarkeit des Textes, betonen aber, dass bei der Verwendung von Lehrer, Schüler etc. immer beide Geschlechter gemeint sind.
Um was wird es in dem Buch inhaltlich gehen? Lange Zeit waren die Diskussionen in der Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik fast ausschließlich von der Methodenfrage (Lautsprache versus Gebärdensprache) bestimmt. Diese lähmende und fachlich extrem verkürzende Fixierung auf die Frage der zu verwendenden Sprachmodalität hat mit dazu beigetragen, dass versäumt wurde, sich um die entscheidenden Fragen zu kümmern: Wie lernen gehörlose und schwerhörige Kinder und was brauchen sie dafür an Unterstützung im Unterricht?
Das vorliegende Buch unternimmt wie bereits gesagt den Versuch, hierzu auf der Basis aktueller nationaler wie vor allem internationaler Forschungsergebnisse aus den letzten Jahren, Antworten zu geben, die gestützt sind auf evidenzbasierten Daten. Es soll praktizierenden Lehrkräften als auch denjenigen, die sich für den Lehrberuf mit gehörlosen und schwerhörigen Kindern entschieden haben, psychologische und entwicklungsbezogene Grundlagen vermitteln, die von Bedeutung sind, wenn man gehörlose und schwerhörige Kinder unterrichtet.
Wir verfügen mittlerweile über einen sehr großen Fundus an empirischen Studien aus den Bereichen der Psychologie, Linguistik, Soziologie, Pädagogik, Sonderpädagogik sowie auch aus etwas entfernteren Gebieten wie Informatik, Anthropologie oder den Neurowissenschaften, aus denen wir vielfältige Erkenntnisse gewinnen können für die Gestaltung von Erziehungs- und Bildungsprozessen sowie speziell für die Unterrichtung von gehörlosen und schwerhörigen Kindern.
Wer ein Buch erwartet, das ihm genau zeigt oder gar vorgibt, wie nun Unterricht mit gehörlosen und schwerhörigen Kindern gemacht wird, wird enttäuscht. Es wäre zu einfach und dem, was wir über das Lernen gehörloser und schwerhöriger Kinder heute wissen, nicht angemessen. Die hohe Diversität der Schülerschaft, die wir heutean den Schulen (Schulen für Gehörlose und Schwerhörige oder an Regelschulen) vorfinden, verbietet genau solch einfache Lösungen nach »Kochbuchrezept«. Was Lehrkräfte heute brauchen, um ihren Unterricht eigenverantwortlich gestalten zu können, sind theoretische Grundlagen des Lernens und was wir darüber von gehörlosen und schwerhörigen Kindern wissen. Lehrer sind die Experten für den Unterricht,
den sie machen. Das vorliegende Buch will ihnen die Grundlagen dafür bereitstellen. Wir verbinden mit dem Buch vor allem auch den Wunsch oder die Hoffnung, dass sich in den deutschsprachigen Ländern in den nächsten Jahren noch mehr als bisher eine fruchtbare Zusammenarbeit von Wissenschaftlern, Eltern, Lehrkräften und all den anderen Fachkräften, die von der Frühförderung bis in den berufsbildenden Bereich hinein in ihrer alltäglichen Praxis mit gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, entwickelt. Eine positive und konstruktive Veränderung der Entwicklungssituation von gehörlosen und schwerhörigen Kindern ist ohne eine solche intensive Kooperation nicht gut möglich. Am Ende eines Vorworts stehen immer Worte des Danks an die vielen Menschen, die das Gelingen eines Buches möglich gemacht haben und die Autoren mit ihrer privaten und/oder fachlichen Unterstützung begleitet haben. Da wir drei Autoren aus drei verschiedenen Ländern sind, wird die Liste der Danksagung ein wenig länger, es ist uns aber wichtig, all die Unterstützer und Unterstützerinnen zu erwähnen und wir machen das dem Alphabet nach, so dass eine schöne »Ländermischung« zustande kommt:
Mireille Audeoud, Barbara Bogner, Freke Bonder, Thorsten Burger, Jürgen Cholewa,
Annet de Klerk, Susan Easterbrooks, Abby Gross, Tobias Haug, Daan Hermans,
Johannes Hennies, Sabine Kaufmann, Silvia Kramreiter, Harry Lang, Kirsten
Ludwig, Ana Mineiro, Gary Morgan, Bernd Rehling, Cathy Rhoten, Henrike Romstedt,
Jorge Samper, Dietmar Schleicher, Linda Spencer, Patricia Spencer, Janie Runion,
Emmie van der Heijden, Ludo Verhoeven, Loes Wauters und Nina Wolters.
Besonderer Dank gilt drei Personen, die die deutsche Version des Buches entscheidend
auf den Weg und schließlich zu einem guten Ende gebracht haben: Einmal
Björn Kerzmann, dem geschäftsführenden Leiter des Median-Verlags, der es möglich
gemacht hat, dieses Buch zu realisieren, Christina Osterwald, ebenfalls vom
Median-Verlag, die wie so oft schon aus einem grauen Manuskript ein optisch ansprechendes
Buch gemacht hat, und nicht zuletzt gilt besonderer Dank Trixi Bücker,
die für die Übersetzung der englischsprachigen Teile des Buches verantwortlich war.
Ganz vielen Dank für die wunderbare Kooperation!
Heidelberg, Sint-Michielsgestel, Rochester, im Juli 2014
Manfred Hintermair, Heidelberg, Deutschland
Harry Knoors, Sint-Michielsgestel, Niederlande
Marc Marschark, Rochester, NY, USA