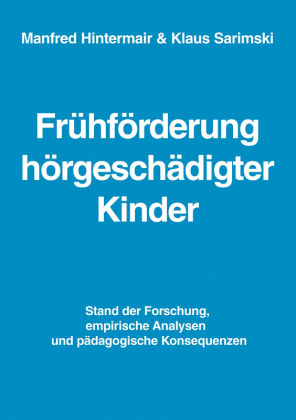Manfred Hintermair und Klaus Sarimski
1. Auflage 2014, 208 Seiten, kartoniert

Beschreibung
ISBN 978-3-941146-50-1
Beschreibung
Im Zusammenhang mit dem 2009 eingeführten Neugeborenen-Hörscreening hat die Frühförderung hörgeschädigter Kinder die Möglichkeit, Kinder mit einem gravierenden Hörverlust und ihre Familien bereits im ersten Lebensjahr zu fördern und zu begleiten. Diese neuen Chancen sind verknüpft mit neuen Herausforderungen für die Fachkräfte, die in der Frühförderung arbeiten. Wissen um grundlegende Entwicklungsprozesse in der ganz frühen Kindheit, Wissen um Entwicklungsbesonderheiten bei kleinen hörgeschädigten Kindern sowie vor allem auch ein durch Familienorientierung verändertes Verständnis der Zusammenarbeit mit Familien bestimmen das Aufgaben- und Handlungsfeld der Frühförderung.
In dem vorliegenden Buch werden aus drei Perspektiven Informationen für die Arbeit der Frühförderung zur Verfügung gestellt. Im ersten Teil des Buches wird ein kompakter Abriss zu aktuellen Forschungsergebnissen im Bereich der frühen Entwicklung von Kindern und zur Situation ihrer Familien gegeben. Im zweiten Teil stellen die Autoren verschiedene Ergebnisse aus eigenen Forschungsarbeiten der letzten Jahre vor und konzentrieren sich dabei auf Aspekte, die für eine familienorientierte Realisierung von Frühförderung besonders wichtig sind. Die Rolle der elterlichen Kompetenzen, die Qualität der Eltern-Kind-Interaktion und die Perspektiven von Frühförderfachkräften zu ihrem Verständnis der Frühförderarbeit werden hier besonders betont. Schließlich werden im dritten Teil des Buches konkrete Empfehlungen vorgestellt, wie eine familienorientierte Frühförderung mit Familien hörgeschädigter Kinder in der Praxis umgesetzt werden kann.
Das Buch vermittelt dem Leser insgesamt einen Überblick zu aktuellen Themen der Frühförderung hörgeschädigter Kinder und stellt dazu den vorliegenden Wissensstand vor.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Erster Teil: Stand der Forschung
1. Chancen und Herausforderungen der Frühförderung hörgeschädigter Kleinkinder – ein Blick in die Forschung
1.1 Entwicklung unter den Bedingungen einer Hörschädigung
1.2 Hörschädigung und familiäres Belastungserleben
1.3 Chancen durch Früherkennung und frühe Versorgung mit einem Cochlea-Implantat
1.4 Hörschädigung und Eltern-Kind-Interaktion
Zweiter Teil: Eigene Studien
2. Belastungserleben von Eltern hörgeschädigter Kinder und relevante Einflussfaktoren – Ergebnisse der FamFrüh-Studie
2.1 Stichprobe
2.2 Untersuchungsinstrumente
2.3 Ergebnisse
2.4 Elternbelastung bei hörgeschädigten Kindern und weitere relevante Merkmale der Frühförderung im Verlauf
2.5 Schlussfolgerungen
3. Eltern-Kind-Interaktion bei hörgeschädigten Kleinkindern – Ergebnisse der EnFaHö-Studie
3.1 Stichprobe
3.2 Untersuchungsmethoden
3.3 Ergebnisse
3.3.1 Entwicklungsstand der Kinder im Verlauf
3.3.2 Eltern-Kind-Interaktion zum ersten Untersuchungszeitpunkt
3.3.3 Zusammenhänge zum Entwicklungsverlauf
3.3.4 Einzelfallbeispiele
3.3.5 Zusammenfassende Interpretation unter Berücksichtigung methodischer Einschränkungen
4. Sichtweisen von Fachleuten und Eltern hörgeschädigter Kinder zu einer familienorientierten Frühförderung – Ergebnisse aus eigenen Studien (PerFak-Studie und FamFrüh-Studie)
4.1 Herausforderungen der Frühförderung hörgeschädigter Kinder aus der Perspektive von Fachkräften – Auswertung von Interviews (zusammen mit Lena Böttcher und Magdalena Marth, geb. Waas)
4.1.1 Die Aufgaben von Fachkräften in einer familienorientierten Frühförderung
4.1.2 Erfahrungen von Fachkräften aus ihrer Arbeit mit Familien mit hörgeschädigten Kleinkindern
4.1.3 Stichprobenbeschreibung
4.1.4 Untersuchungsinstrumente und Durchführung
4.1.5 Ergebnisse
4.1.5.1 Für die Frühförderung relevante Merkmale der Familiensituation
4.1.5.2 Merkmale der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Frühförderinnen
4.1.5.3 Erfahrungen mit Kooperationspartnern
4.1.5.4 Sicht der Frühförderung aus der Perspektive der Fachkräfte
4.1.5.5 Arbeitsbedingungen der Frühförderung
4.1.5.6 Frühförderung mit Familien in besonderen Lebenslagen
4.1.5.7 Exkurs: Frühförderung mit Familien mit Migrationshintergrund
4.2 Zufriedenheit der Familien mit der Frühförderung – ausgewählte Ergebnisse der FamFrüh-Studie
4.2.1 Stichprobenbeschreibung
4.2.2 Untersuchungsinstrumente und Durchführung
4.2.3 Ergebnisse
Dritter Teil: Praktische Konsequenzen
5. Praxis der Frühförderung
5.1 Empowerment – zentrale Haltung und Aufgabe einer familienorientierten Frühförderung
5.2 Praxisorientierte Bausteine einer familienorientierten Frühförderung
5.3 Familienorientierte Frühförderung mit hörgeschädigten Kindern braucht hörgeschädigtenspezifische Expertise!
Literatur
Autoren
Anhang
Vorwort
Die Frühförderung hatte im Bildungssystem für gehörlose und schwerhörige Kinder schon immer eine wichtige Rolle inne: Dort werden die entscheidenden Weichen für die Zukunft der Kinder in Bezug auf ihre schulische und berufliche Karriere, aber vor allem auch für ihre sozial-emotionale Entwicklung gestellt. In der Frühförderung werden die Fundamente gelegt, auf denen in allen nachfolgenden Bildungsinstitutionen wie Kindergarten, Schule und Einrichtungen zur beruflichen Ausbildung aufgebaut werden kann und wesentliche Kompetenzen in der Erlangung von Bildungszielen weiterentwickelt werden können. Diese Funktion der Frühförderung hat seit der Einführung eines flächendeckenden Neugeborenen-Hörscreenings nochmals entscheidend an Bedeutung gewonnen. Der Erfolg einer frühen Erfassung eines kindlichen Hörverlusts steht und fällt mit der Qualität der Förderung, die möglichst zeitnah zum Screening einsetzen soll. Die Anforderungen an die Frühförderung haben sich aber durch die nun möglich gewordene frühe Erfassung in vielfacher Weise verändert. Insbesondere gilt es, das allgemeine Wissen um frühkindliche Entwicklungsprozesse zu verknüpfen mit dem spezifischen Wissen um die Auswirkungen einer Hörschädigung auf die sprachliche, kognitive und sozial-emotionale Entwicklung hörgeschädigter Kinder.
Dazu ist es wichtig, Wissen und Erfahrungen aus Forschung und Praxis der Frühförderung zusammenzufassen und zu dokumentieren. Das vorliegende Buch unternimmt den Versuch, hierzu aus verschiedenen Perspektiven Beiträge zu liefern, die den aktuellen Stand der Frühförderung und die daraus erwachsenden Erfordernisse für die Praxis der Frühförderung hörgeschädigter Kinder sichtbar machen. Es ist gegliedert in drei Teile.
Im ersten Teil werden wir zu einigen zentralen Bereichen der frühen Erziehung und Bildung hörgeschädigter Kinder aufzeigen, was die internationale Forschung zu diesen Themen an aktuellen Informationen und Fakten bereithält (Kapitel 1). Es geht um grundsätzliche Fragen der Entwicklung hörgeschädigter Kinder, es geht um die Situation der Familien und hier insbesondere um die Frage, welche Faktoren für das Belastungserleben von Bedeutung sind. Weiter werden Ergebnisse vorgestellt, die aufzeigen, welche Möglichkeiten der lautsprachlichen Entwicklung durch frühe Erfassung und frühe technische Versorgung möglich geworden sind, sowie, welche Momente die Eltern-Kind-Interaktion im Kontext einer Hörschädigung beeinflussen.
Im zweiten Teil des Buches, der die Kapitel 2, 3 und 4 umfasst, stellen wir aus verschiedenen Projekten, die wir in den letzten Jahren gemeinsam durchgeführt haben, Ergebnisse vor, die auf dem Hintergrund der Befunde aus dem ersten Teil des Buches vorhandenes Wissen anreichern, aber auch erweitern und vor allem speziell die deutsche Situation näher unter die Lupe nehmen. Wir werden hier in Kapitel 2 aus dem Projekt FamFrüh (Familienbedürfnisse und familienorientierte Beratung in der Frühförderung behinderter Kleinkinder) berichten, bei dem u.a. die Belastungssituation von Eltern sehr junger Kinder betrachtet wird und vor allem diejenigen Faktoren, die zur Belastungsreduzierung beigetragen haben, in einen Gesamtzusammenhang gestellt werden. In Kapitel 3 stellen wir einige Ergebnisse aus der Studie EnFaHö (Entwicklungsverläufe und Familienerleben bei Kleinkindern mit Hörschädigung) vor, in der wir an einer kleinen Gruppe von hörgeschädigten Kindern und ihren Eltern vor allem die Eltern-Kind-Interaktionen und deren Beeinflussungsfaktoren genauer analysiert sowie Bezüge zu Entwicklungsergebnissen der Kinder hergestellt haben. In Kapitel 4 geht es um die Arbeit der Frühförderung und wie diese beurteilt wird – einmal aus der Perspektive der Fachleute (PerFak-Studie „Perspektiven von Fachkräften in der Frühförderung“) und zum anderen aus der Perspektive der Eltern mit der Frage, welchen Gewinn Eltern aus der Frühförderung ziehen, aber auch, welche Problembereiche sie für sich und ihr Kind wahrnehmen (FamFrüh-Studie). Wir haben dazu einerseits zahlreiche qualitative Interviews mit Frühförderfachkräften durchgeführt, zum anderen mit Fragebogeninventaren die Zufriedenheit der Eltern mit der Qualität der Frühförderung erhoben. Einige wenige Teile der Ausführungen in Kapitel 2 und 4 haben wir an anderer Stelle bereits publiziert, der Großteil der vorgestellten Ergebnisse beruht jedoch auf bisher noch nicht publizierten Daten.
Der dritte Teil des Buches ist Fragen der Praxis gewidmet (Kapitel 5). Hier wollen wir zum einen eine aus der Empowermentphilosophie gespeiste Begründung für eine familienorientierte Frühförderung liefern und in einem nächsten Schritt dann sehr konkret Bausteine vorstellen, wie eine familienorientierte Frühförderung in der Praxis aussehen und umgesetzt werden kann. Schließlich werden diese praxisbezogenen Grundlagen vernetzt mit Besonderheiten, die sich für die Frühförderung im Kontext einer Hörschädigung ergeben und die bei der Realisierung der Zusammenarbeit mit den Familien berücksichtigt werden müssen.
Für die Leserinnen und Leser des Buches bieten die drei Teile des Buches unterschiedliche Schwerpunkte, die je nach Interesse oder dem Handlungsfeld, in dem man tätig ist, gewählt werden können. Für alle – egal, ob wissenschaftlich interessiert oder aus der Praxis kommend – bietet der erste Teil eine kompakte Information zum „state of the art“ in der Frühförderung hörgeschädigter Kinder. Der zweite Teil dürfte sicherlich im Wesentlichen für wissenschaftlich Interessierte von Bedeutung sein, während der dritte Teil insbesondere die Frühförderinnen und Frühförderer, die an den Frühförderstellen in Deutschland arbeiten, ansprechen wird und für ihre konkrete Arbeit Impulse geben kann.
Um alle Teile des Buches und seine Inhalte für möglichst viele Leserinnen und Leser, egal ob aus Wissenschaft oder Praxis kommend, gleichermaßen attraktiv zu machen, haben wir nach jedem Teilkapitel eine Zusammenfassung der wesentlichen Aussagen, Erkenntnisse und Herausforderungen für die Arbeit mit Familien kleiner hörgeschädigter Kinder in einem Kasten zusammengestellt.
Am Ende dieser einleitenden Worte wollen wir die Gelegenheit nutzen, Dank auszusprechen an alle, die uns bei der Durchführung unserer Studien in den letzten Jahren unterstützt haben sowie das Zustandekommen dieses Buches möglich gemacht haben.
Das sind einmal die Frühfördereinrichtungen, die uns die Kontakte zu Familien mit einem hörgeschädigten Kind vermittelt haben und dafür viel Zeit und Energie investiert haben: Bernd Gerbig vom Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation in Frankenthal, Cornelia Schmalbrock von der Schule am Sommerhoffpark in Frankfurt, Irmgild Schulte-Möckel vom Hör-Sprachzentrum Heidelberg-Neckargemünd, Martina Wende vom Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation in München, Stefanie Getrost vom Zentrum für Hörgeschädigte in Nürnberg, Maria Wollinger von der Dr.-Karl-Kroiß-Schule in Würzburg sowie alle Frühförderinnen und Frühförderer an diesen Einrichtungen!
Dank gilt auch den Eltern der FamFrüh-Studie, die sich mehrmals Zeit genommen haben, umfangreiche Fragebögen auszufüllen.
Danken wollen wir ebenfalls den Frühförderinnen (und auch einem Frühförderer) der Frühförderstellen in Augsburg, Frankenthal, Heidelberg-Neckargemünd, Karlsruhe, Mannheim und München, die sich für die Interviews in der PerFak-Studie zur Verfügung gestellt haben.
Dank geht auch an die ehemaligen Studierenden der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, die im Rahmen ihrer Abschlussarbeiten zur Erhebung zahlreicher Daten, die hier vorgestellt werden, beigetragen haben: Verena Augustin, Lena Böttcher, Barbara Dittmann, Cornelia Egelhaaf, Nina Kathrin Engelhardt, Johannes Ernst, Kathrin Frey, Sarah Fröhlich, Eva-Maria Futas, Anja Hommel, Anja Hüeber, Birgit Kern, Tanja Leber, Catharina Lochthowe, Heike Lorenzen, Silke Lumma, Magdalena Marth (geb. Waas), Renate Meergans, Tina Müller, Tabea Post, Alena Rieble, Anna Karoline Rinne, Martina Ruhnke (†), Frank Scheible, Jasmin Schierling, Mirjam Schmitt, Frauke Schulz, Anja Striebel, Luise Urban und Hanna Waldvogel.
Dank geht ebenso an die Pädagogische Hochschule Heidelberg, die die Durchführung der FamFrüh-Studie von 2009 bis 2011 aus ihren Forschungsmitteln finanziell unterstützt hat.
Schließlich gilt unser Dank dem Median-Verlag, insbesondere Christina Osterwald, die auch dieses Mal wieder mit unermüdlichem Eifer und großer Sorgfalt dazu beigetragen hat, dass das Buch wie geplant fertig geworden ist.
Heidelberg/München, im Juni 2014
Manfred Hintermair
Klaus Sarimski