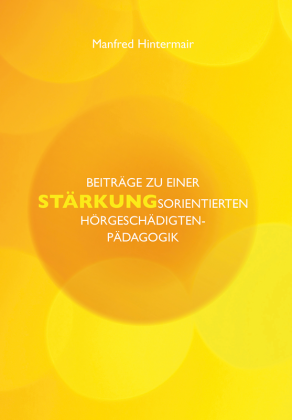Unsere Versandbuchhandlung auch für andere Bücher
![]() Sie können selbstverständlich bei uns auch Bücher bestellen, die nicht in unserem Onlineshop stehen.
Sie können selbstverständlich bei uns auch Bücher bestellen, die nicht in unserem Onlineshop stehen.
Bestellbarkeit (aus nahezu allen Bereichen) einfach über Titel | Verlag | ISBN
Schreiben Sie uns dazu einfach eine E-Mail-Anfrage: vertrieb@median-verlag.de

Beschreibung
ISBN 978-3-941146-93-8
Beschreibung
Die Beiträge dieses Buches befassen sich mit der Bedeutung von STÄRKUNG im Kontext verschiedener Fragestellungen der Hörgeschädigtenpädagogik. Dabei beinhaltet Stärkung mehr, als sich in der pädagogischen Arbeit ausschließlich an Stärken zu orientieren. Um zur Stärkung hörgeschädigter Kinder und ihrer Familien beizutragen, müssen auch die spezifischen Herausforderungen durch eine Hörschädigung sowie die potenziell damit verbundenen Probleme für die kindliche Entwicklung berücksichtigt werden. Ebenso müssen die sozialen Lebensrealitäten der Kinder und ihrer Familien in die Förderung und Unterstützung einbezogen werden.
Aus einer dezidiert psychosozialen Perspektive werden folgende für eine stärkungsorientierte Hörgeschädigtenpädagogik bedeutsame Themen behandelt:
- Kräfte wecken
- Impulse setzen
- Emotionen thematisieren
- Kompetenzen fördern
- Entwicklungsrisiken reduzieren
- Resilienz stärken
- Anerkennung und Zugehörigkeit ermöglichen
- Lebenszufriedenheit anstreben
- Gesundheitsförderliche Prozesse initiieren
- Humor im Gepäck haben
- Partizipationsprozesse gemeinsam gestalten
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort (Heiner Keupp)
Einführung
Kapitel 1
Kräfte wecken
Der Beitrag von Empowerment, Lebensweltorientierung und Systemtheorie
Kapitel 2
Impulse setzen
Beratende Begleitung von Eltern hörgeschädigter Kinder als Balanceakt zwischen emotionaler Unterstützung und heraufordernder Aktivierung
Kapitel 3
Emotionen thematisieren
Wie Eltern die Emotionsentwicklung hörgeschädigter Kinder unterstützen können
Kapitel 4
Kompetenzen fördern
Aufgezeigt am Beispiel der Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen hörgeschädigter Kinder
Kapitel 5
Entwicklungsrisiken reduzieren
Was wir dazu aus der Forschung über Verhaltensauffälligkeiten bei hörgeschädigten Kindern lernen können
Kapitel 6
Resilienz stärken
Besondere Herausforderungen für hörgeschädigte Kinder?
Kapitel 7
Anerkennung und Zugehörigkeit ermöglichen
Warum inklusiv beschulte hörgeschädigte Kinder für ihre Identitätsarbeit darauf besonders angewiesen sind
Kapitel 8
Lebenszufriedenheit anstreben
Was es aus Sicht beruflich erfolgreicher Menschen mit einer Hörschädigung zu einem erfüllten Leben braucht
Kapitel 9
Gesundheitsförderliche Prozesse initiieren
Um ‚gesund leben‘ zu können, braucht es gute Bedingungen
Kapitel 10
Humor im Gepäck haben
Wie Freude und Spaß zu einem besseren Lernklima und mehr Lernerfolg beitragen
Kapitel 11
Partizipationsprozesse gemeinsam gestalten
Chancen und Herausforderungen aktiver Beteiligung von Betroffenen an Entscheidungsprozessen
Literatur
Nachweise
Vorwort
Einführung
„Education must always be organized in the perspective of life as a whole“
(Beth Daigle, 1995, p. 68)
Die Beiträge dieses Buches befassen sich mit der Bedeutung von Stärkung im Kontext verschiedener Fragestellungen der Hörgeschädigtenpädagogik. Es ist dabei kein Versehen, wenn der Begriff der Stärkung und nicht der der Stärke verwendet wird. Trotz ihrer semantischen Ähnlichkeit beinhalten Stärkungsorientierung und Stärkenorientierung nicht dasselbe. Der Begriff der Stärkung ist konzeptionell weiter gefasst. Das bedeutet, dass die Stärken von Menschen selbstredend einen ausgewiesenen Stellenwert in einer Pädagogik der Stärkung haben. Die konzeptionellen Überlegungen erschöpfen sich jedoch nicht darin, sondern der Blick wird vielmehr auf diejenigen Faktoren erweitert, die für die Stärkung der Kinder wichtig sind. Und zur Stärkung gehört mehr als nur auf die Stärken zu setzen!
So wichtig es war, sich von defizitorientierten Sichtweisen früherer Jahre abzuwenden und zunehmend die Stärken von Menschen in den Fokus pädagogischen Handelns zu rücken, so sehr kann eine übertriebene „Stärken-Euphorie“ zu einer Verengung des Blickwinkels mit möglicherweise gravierenden Folgen für die Entwicklung hörgeschädigter Kinder beitragen. Es kann nämlich dazu führen, dass die Gefährdungen von Entwicklungsprozessen im Zusammenhang mit einer Hörschädigung nicht (mehr) ausreichend wahrgenommen und berücksichtigt werden, und man dadurch den spezifischen Bedürfnissen hörgeschädigter Kinder nicht ausreichend gerecht wird. Den Fokus auf positive Entwicklungsziele, psychosoziales Wohlbefinden und Lebensqualität zu richten, sollte also keinesfalls dazu führen, lebenserschwerende Realitäten für hörgeschädigte Kinder aus den Augen zu verlieren (oder gar zu leugnen) und zu glauben, „positiv denken“ allein würde schon heilsam sein.
Um diese Realitäten beschreiben und auch, um eine gleichberechtigte Teilhabe hörgeschädigter Kinder ermöglichen zu können, ist es nach wie vor notwendig (nicht nur, aber auch), Unterschiede in der Entwicklung hörender und hörgeschädigter Kinder in die Diskussionen miteinzubeziehen, auch wenn dies in den aktuellen Diskursen durchaus umstritten ist (vgl. Holcomb et al., 2025; Scott et al., 2025; à Kapitel 5: „Entwicklungsrisiken reduzieren“). Allerdings müssen diese Vergleiche aus einer Differenzperspektive und nicht aus einer Defizitperspektive vorgenommen werden. Das bedeutet: Unterschiede nicht defizitär verbuchen, sondern verstehend einordnen und die gewonnenen Erkenntnisse zur Stärkung hörgeschädigter Kinder nutzen! Es muss intensiv daran gearbeitet werden, wie unter Berücksichtigung dieser Unterschiede Unterstützung und Förderung für hörgeschädigte Kinder auf den Weg gebracht werden können, um Benachteiligungen zu vermeiden, Barrieren abzubauen und Lern- und Entwicklungsprozesse bestmöglich zu unterstützen.
Dieser weiter gefasste Blick auf Stärkung steht im Einklang mit den Grundsätzen der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF, 2005). Darin wird gefordert, die bio-psycho-sozialen Aspekte von Behinderungen unter Berücksichtigung der Kontextfaktoren systematisch zu erfassen. Im Falle hörgeschädigter Kinder bedeutet dies zunächst, dass eine sorgfältige Beschreibung und Analyse ihrer Entwicklungsbesonderheiten (die natürlich auch ihre Stärken beinhalten) notwendig ist.
Aus der Perspektive der ICF ergibt sich aber noch ein weiterer wichtiger Aspekt einer Pädagogik der Stärkung: Es müssen auch die Faktoren des Umfelds, in dem hörgeschädigte Kinder aufwachsen, in den Blick genommen werden, die für ihre sprachliche, soziale und emotionale Entwicklung von Bedeutung sind. Es geht um die differenzierte Wahrnehmung der sozialen Lebensrealitäten der Kinder und deren Berücksichtigung bei der Förderung und Unterstützung. Viele hörgeschädigte Kinder und ihre Familien können – vor allem ganz am Anfang – nicht (sofort) aus einer Position der Stärke(n) heraus agieren, sind gleichwohl aber auf Stärkung angewiesen.