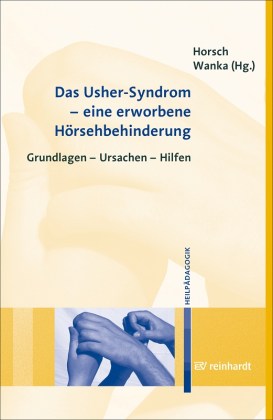Unsere Versandbuchhandlung auch für andere Bücher
![]() Sie können selbstverständlich bei uns auch Bücher bestellen, die nicht in unserem Onlineshop stehen.
Sie können selbstverständlich bei uns auch Bücher bestellen, die nicht in unserem Onlineshop stehen.
Bestellbarkeit (aus nahezu allen Bereichen) einfach über Titel | Verlag | ISBN
Schreiben Sie uns dazu einfach eine E-Mail-Anfrage: vertrieb@median-verlag.de
Herausgegeben von Ursula Horsch und Andrea Wanka
2013, 235 Seiten, kartoniert

Beschreibung
ISBN 978-3-497-02329-5
Beschreibung
Das Fachbuch zum Usher-Syndrom vereint das Wissen der relevanten Fachdisziplinen. ExpertInnen aus Medizin, Psychologie und Pädagogik vermitteln die Grundlagen dieser Hörsehbehinderung, ihre Ausprägungen und Symptome sowie innovative Therapieansätze und Hilfsangebote. Themenbereiche sind u. a. die aktuelle molekular- und humangenetische Forschung, invasive Methoden sowie Aspekte der visuellen, auditiven, taktilen und vestibulären Wahrnehmung. Spezifische Hilfsmittel und Möglichkeiten professioneller Begleitung werden vorgestellt und diskutiert. Dabei finden Taubblindenassistenzen, Wohnprojekte und Mobilitätstrainings ebenso Berücksichtigung wie Formen der Selbsthilfe und die Perspektive von Betroffenen.
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort von Mary Guest
Vorwort der Herausgeberinnen
1 Medizinische Perspektiven
Das Usher-Syndrom
(Schwerpunkt visuelles System)
Von Klaus Rohrschneider
M. Usher aus audiologischer Sicht
Von Jürgen Neuburger
Usher-Syndrom – ein variables Krankheitsbild aus hals-nasen-ohrenärztlicher Sicht
Von Markus Pfister und Andreas Breß
Zur Genetik des Usher-Syndroms
Von Hanno Jörn Bolz
Gentherapeutische Ansätze für das Usher-Syndrom
Von Kerstin Nagel-Wolfrum
Usher-Syndrom-Proteinnetzwerke
Von Uwe Wolfrum
Das subretinale elektronische Implantat zur Wiederherstellung von Seheindrücken:
künftig Einsatz auch beim Usher-Syndrom möglich?
Von Eberhart Zrenner und Ditta Zobor
Retina-Implantat: Epiret
Von Steffen Suchert
2 Pädagogische Perspektiven
Professionelle Begleitung von Menschen mit Hörsehbehinderung/Taubblindheit – Impulse einer Taubblindenpädagogin
Von Sigrid Andrä
Taktil gebärden – die taktile Gebärdensprache
Von Hanne Pittroff
Usher-Syndrom und CI – pädagogische Perspektiven
Von Christel Skusa
Taubblindenassistenz
Von Almuth Kolb
3 Psychologische Perspektiven und Unterstützungsmöglichkeiten
Usher-Ambulanz an der Charité Berlin – interdisziplinäre Sprechstunde als Angebot für Usher-Betroffene
Von Klaus Rüther und Manfred Gross
Untersuchung zu Stresserfahrungen und -ursachen bei Usher-Syndrom – Ergebnisse und rehabilitationspädagogische Maßnahmen
Von Nadja Högner
Low Vision für Menschen mit Usher-Syndrom
Von Regina Berg
Mobilitätstraining bei Menschen mit Usher-Syndrom
Von Regina Berg
Weiter als die Sinne reichen: modellbasierte Assistenzsysteme für Menschen mit Hörsehschädigungen
Von Andreas Hub
4 Perspektiven von Betroffenen und deren Umfeld
Die Entwicklung der Selbsthilfe bei Usher-Betroffenen
Von Rosemarie Große-Wilde, Rainald von Gizycki und Jan Sebastian Klaes
Stolpersteine im jungen Leben eines Usher-betroffenen Menschen – das Umfeld aus psychotherapeutischer Sicht
Von Cordula von Brandis-Stiehl
Seelsorge für Menschen mit Usher-Syndrom am Beispiel eines christlichen Zugangs
Von Peter Hepp
Leben mit Usher-Syndrom Typ III
Von Hendrik Klaes-Klagge
Usher und Partnerschaft – oder: Sehen + Hören = Verstehen?
Von Oliver Riedel und Sarah Forberger
Menschen mit Usher-Syndrom in der Schweiz
Von Stefan Spring
Die Situation in Österreich aus der Sicht einer Betroffenen und einer Fachkraft
Von Brigitte Baumann und Barbara Latzelsberger
Autorinnen und Autoren
Sachregister
Leseprobe
Ertastbare Wege
Menschen mit Taubblindheit erlangen häufig nicht genügend Informationen über das Gehör. Verfügen sie noch über Sehvermögen, dann entwickeln sie oftmals das Gefühl, noch genug zu sehen und dadurch alles kompensieren zu können. Dies trügt jedoch in vielen Fällen. Tasten wird früher oder später zur wichtigsten Technik. Das bedeutet, dass Wege gesucht werden müssen, die über eine gut ertastbare Grenze verfügen wie z. B. Hauswände und Rasenkanten. Klienten mit verbliebenem Sehvermögen sollten Farbkontraste (grüne Wiese, heller Sandweg), Klienten mit Hörvermögen Höreindrücke (Autogeräusche) nutzen.
Nahezu alle Klienten mit Usher-Syndrom gehen in der Mitte des Weges. Ihr Gesichtsfeld ist an der Peripherie eingeschränkt. Es ist deshalb sinnvoll, an der von der Straße abgewandten Seite zu gehen. So ist der Weg auch bei Dunkelheit zu bewältigen. Spätestens sobald es dunkel wird, müssen die Klienten auf den Tastsinn zurückgreifen. Deshalb wird im Training geübt, Wege unter diesen Aspekten zu bewältigen.
Straßenüberquerungen
Gesicherte Übergänge – wie Ampeln, Zebrastreifen oder verkehrsberuhigte Straßen – sind grundsätzlich zu bevorzugen. Sicherheitsüberquerungen sind immer anzuraten. Die Technik, die sich bisher bewährt hat, kommt aus der klassischen Blindentechnik (Abb. 2). Der Betroffene muss als Verkehrsteilnehmer gesehen werden, z. B. indem er den Langstock an der Bordsteinkante diagonal von sich gestreckt hält. So sind auch die Autofahrer informiert. Wenn ein Fahrzeugfahrer anhält, gibt der Betroffene ein Zeichen, dass er dies gesehen hat (z. B. Winken), und prüft die andere Seite der Fahrbahn, bevor er geht. Sollte ein Mensch mit Hörsehbehinderung/Taubblindheit kein verbliebenes Sehvermögen und keinen Höreindruck mehr haben, rate ich von einer Überquerung ohne Hilfe ab! Es wäre möglich, dass er einen Passanten um Hilfe bittet.
Markante Punkte
Markante Punkte sind sowohl gut sichtbare – bei Menschen mit Usher-Syndrom evtl. für den Tag – und gut ertastbare – evtl. für die Nacht – selbst angebrachte Punkte wie beispielsweise in Abb. 3 die drei Punkte, die in diesem Fall auf einen gegenüberliegenden Gang hinweisen.
Darüber hinaus können markante Punkte Orte oder Ecken mit hohem Wiedererkennungswert sein. Für den Klienten mit Usher-Syndrom ist es wichtig, dass diese markanten Punkte auch bei Dunkelheit auffindbar sind. Daher ist es besser, taktile Objekte zu suchen und mit einzubeziehen. Manchmal kann man auch Leuchtreklamen mit einbeziehen. Oft sind taktile und visuelle Hinweise vorhanden. Gerade am Anfang ist es für jeden Klienten eine Hilfe, darauf aufmerksam gemacht zu werden.
Dunkeltraining
Für alle Klienten mit Usher-Syndrom biete ich Dunkeltraining an, da sie nachtblind sind. Vielen Klienten zeigt es, wie notwendig es ist, Wege neu zu erarbeiten. Den Klienten wird jetzt bewusst, welche Situation in der Zukunft auf sie zukommen kann. Dunkeltraining sollte erst in zeitlichem Abstand zum Orientierungs- und Mobilitätsgrundtraining beginnen. Die Technik ist dann sicherer, hat sich gefestigt und der Klient hat Vertrauen in sich und seine Fähigkeiten gewonnen. Das Training in der Dunkelheit ist ein wichtiges Element. Manchmal haben die Klienten Angst und sind aufgeregt. Wenn sich diese Ängste nicht überwinden lassen, sollte der Klient bei Dunkelheit nicht mehr alleine gehen. Nach dem Grundtraining und dem Beherrschen der Technik ist vom Klienten mehr Sicherheit zu spüren. Es macht jedem Einzelnen Mut und schenkt Selbstvertrauen. Das ist teilweise gleichbedeutend für die Zuversicht bezüglich der Bewältigung all der Hindernisse, die sich einem Klienten mit Usher-Syndrom in Zukunft in den Weg stellen können. Es ist gut zu schaffen, jedoch sind gezieltes Üben und ein langsames Steigern des Schweregrads notwendig.
Ein Training mit Augenbinde lehne ich ab. Es kann nicht vermitteln, wie ein Klient mit der starken Blendung durch Scheinwerferlicht von Autos zurechtkommen muss, und kann somit auch den Umgang damit nicht trainieren. Es ist sinnvoll, einschätzen zu lernen, ob der Scheinwerfer z. B. von einem Fahrrad oder einer Straßenbahn kommt. Das eingeschränkte Gesichtsfeld ist für so manche Fehlinterpretation verantwortlich. Straßenbeleuchtungen können heller sein als geahnt und dadurch effektiv nutzbare Seheindrücke vermitteln.
Rezension
aus Spektrum Hören Ausgabe 2/2014
Anschauliches Wissen, praktische Hilfen und persönliche Einblicke
Ursula Horsch und Andrea Wanka (Hrsg.): Das Usher-Syndrom – eine erworbene Hörsehbehinderung. Grundlagen, Ursachen, Hilfen. Reinhardt-Verlag, 2012, 235 Seiten.
Das erste Fachbuch zum Usher-Syndrom in deutscher Sprache war lange überfällig. Neue Forschungsergebnisse, Fortschritte in der Rehabilitation und allgemeine Informationen waren bisher sehr verstreut und oft nur in englischer Sprache aufzufinden. Die Herausgeberinnen Ursula Horsch und Andrea Wanka führen zahlreiche Beiträge in vier Themenkomplexen zusammen: Grundlagen und neue Entwicklungen im medizinischen Bereich, pädagogische und psychologische Perspektiven und Unterstützungsmöglichkeiten sowie Erfahrungsberichte der Betroffenen.
Das Fachbuch richtet sich sowohl an medizinisches und pädagogisches Fachpersonal als auch an Betroffene und ihre Angehörigen. Für die thematisch sehr breit gefächerten und sich ergänzenden Beiträge konnten die Herausgeberinnen profilierte Fachleute und engagierte Betroffene gewinnen. Ganz gleich, ob Details der Usher-Genmutationen, die taktile Gebärdensprache oder persönliche Erlebnisse Betroffener im Vordergrund stehen – den Autoren gelingt die Gratwanderung zwischen der Vermittlung notwendiger Fachinfos samt einschlägiger Fachbegriffe und einer verständlichen und flüssigen Sprache. Gerade die gut aufbereiteten medizinischen Fachbeiträge bilden so die Grundlage für die spannenden Informationen zu den neuesten Entwicklungen bei Retina-Implantaten oder der Cochlea-Implantat-Versorgung.
Als Angehöriger und medizinisch nicht vorgebildeter Laie kann man allerdings problemlos direkt zum pädagogischen und psychologischen Teil blättern, bevor man sich der klinischen Seite des Usher-Syndroms zuwendet. Themen wie Taubblindenassistenz oder Angebote zum Mobilitätstraining tangieren direkt die Fragen und Bedürfnisse der betroffenen Familien. Sämtliche Beiträge in beiden Kapiteln geben sehr übersichtlich Auskunft über die aktuell verfügbaren Möglichkeiten der Unterstützung im Alltag und Beruf.
Besonders wertvoll für die lebenspraktischen Fragen sind die Beiträge der Betroffenen. Von der Entwicklung der Selbsthilfe über die christliche Seelsorge bis hin zu sehr persönlichen Schilderungen reichen die Themen. Bei aller emotionalen Wirkung gleiten die Autoren nie in übertrieben mitleidserregende oder intime Schicksalserzählungen ab. Stattdessen haben sie eine erfrischende Mischung aus Nüchternheit und Humor getroffen, die zeigt, wie mutig und lebensfroh Betroffene mit der Diagnose Usher-Syndrom umgehen. In zwei Beiträgen werden zudem Lebenssituation, Netzwerke und Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene in Österreich und der Schweiz vorgestellt – ein Muss für ein deutschsprachiges Grundlagenwerk.
Ein übersichtliches Inhaltsverzeichnis und ein Sachregister helfen beim direkten Einstieg. Nahezu jeder Beitrag beinhaltet Literaturhinweise und fachliche Quellen, so dass interessierte Leser ohne Weiteres ihr Wissen vertiefen können. Die Tatsache, dass der größte Teil der zitierten Literatur auf Englisch erschienen ist (zumindest im medizinischen Teil), macht deutlich, wie wichtig und notwendig dieses Buch für die Usher-Gemeinde im deutschen Sprachraum sein wird. Neben der gedruckten Ausgabe ist eine E-Book-Version zum gleichen Preis erhältlich.
Mit „Das Usher-Syndrom – eine erworbene Hörsehbehinderung“ ist den Herausgeberinnen ein Werk gelungen, das Fachkräfte und Laien gleichermaßen als Leser ernst nimmt und wertvolles Wissen zum Usher-Syndrom vermittelt. Da sowohl in Forschung, Gesellschaft und Politik in den nächsten Jahren zweifellos weitere Fortschritte erzielt werden, gibt es hoffentlich zu gegebener Zeit eine zweite Auflage. Darin könnten neben den Neuerungen in den genannten Bereichen auch Themen wie sozialrechtliche Aspekte, Berufseinstieg und Berufsleben sowie aktuelle Forschungsarbeiten noch stärker berücksichtigt werden.
Christiane Klaes